Über Veranstaltungen mit unterschiedlichen Kooperationspartner:innen finden sie hier weitere Infos.
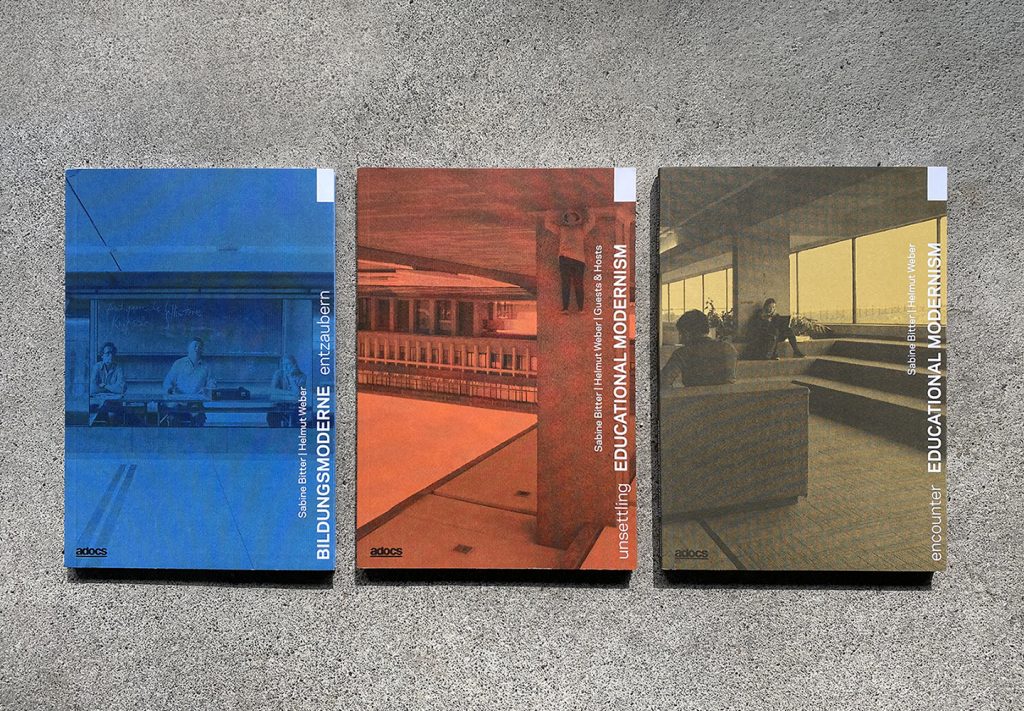
Bildungsinfrastrukturen der Moderne
Sabine Bitter & Helmut Weber,
Jeff Derksen, Maja Lorbek
2. Juni 2025
ÖGFA Infrastruktur und Transformation:
Sabine Bitter & Helmut Weber: Bildungsmoderne – Educational Modernism
Jeff Derksen: The Spatiality and the Temporality of the Educational Encounter
Maja Lorbek: Mapping Education, 1869–1970: Schools as Sites of Social Infrastructure, State-Building, and Liberation
Michael Klein: Moderation
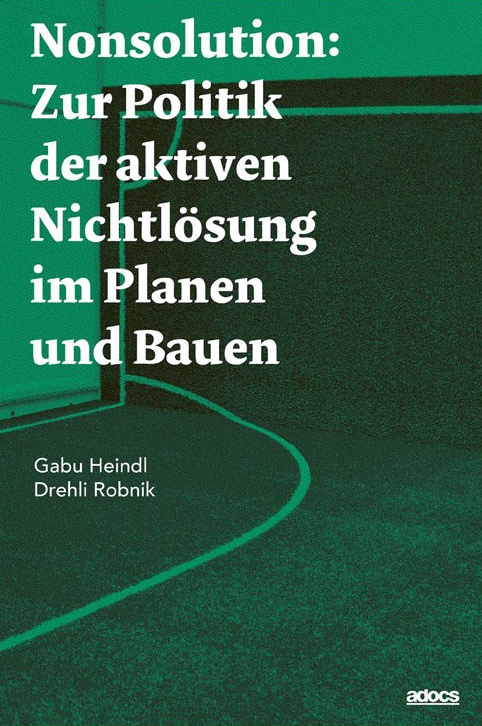
Nonsolution:
Zur Politik der aktiven Nichtlösung im Planen und Bauen
Gabu Heindl und Drehli Robnik
10. April 2025
ÖGFA Infrastruktur und Transformation:
Das erst kürzlich bei Adocs erschienene Buch Nonsolution. Zur Politik der aktiven Nichtlösung im Planen und Bauen ist ein Plädoyer für eine andere Planung: Gegen die als alternativlos dargestellte Maßnahme, gegen die verordnete Lösung bringen Gabu Heindl und Drehli Robnik Nonsolution in Stellung. Dabei meint Nonsolution entschieden nicht, dass es Lösungvorschläge nicht geben soll. Nonsolution ist vielmehr als eine demokratische Praxis zu verstehen, die dafür eintritt, die Probleme schon selbst zu stellen, ohne sie vorschnell zu lösen, die Verhandlungsraum einfordert, mutig Antworten gibt und dennoch auf Weiterentwicklung beharrt. Das Buch zieht dafür Facetten aus dem Denken Siegfried Kracauers heran und erschließt sie für den Bereich der Planung: Ein Argument für Planung als eine politisierte, das heißt konfliktuelle und zukunftsoffene Praxis.
Mit: Gabu Heindl und Drehli Robnik
Moderation: Christina Linortner und Michael Klein / ÖGFA
Nonsolution. Zur Politik der aktiven Nichtlösung im Planen und Bauen (Adocs, 2024)
Gabu Heindl, Drehli Robnik
Gabu Heindl ist Professorin und Leiterin des Fachgebiets ARCHITEKTUR STADT ÖKONOMIE | Bauwirtschaft und Projektentwicklung an der Universität Kassel. Als Architektin und Stadtplanerin betreibt sie das Büro GABU Heindl Architektur in Wien. Sie praktiziert, forscht und publiziert mit dem Fokus Wohnen, öffentlicher Raum und Verteilungsfragen in Architektur und Stadtplanung. Zuletzt erschienene Monografie: Stadtkonflikte. Radikale Demokratie und Architektur und Stadtplanung (2020) und der Studienbericht: Gerechte Stadt muss sein! (2022).
Drehli Robnik ist Essayist und Theoriedienstleister in Sachen Politik, Film und Geschichte sowie Edutainer und Musikveranstalter (Sonntag’sdisco). (Mit-)Herausgeber von Büchern zu Siegfried Kracauer, zu den X-Men und (2022 mit Joachim Schätz) zu Männergewalt im domestic thriller. Autor zu Monografien im Anti-Nazi-Widerstand, Jaques Rancière, Kontrollhorrorkino, Pandemie-Spielfilm sowie zu populärem Kino und Politik. Zuletzt: Flexibler Faschismus. Siegfried Kracauers Analysen rechter Mobilisierungen, damals und heute (2024).
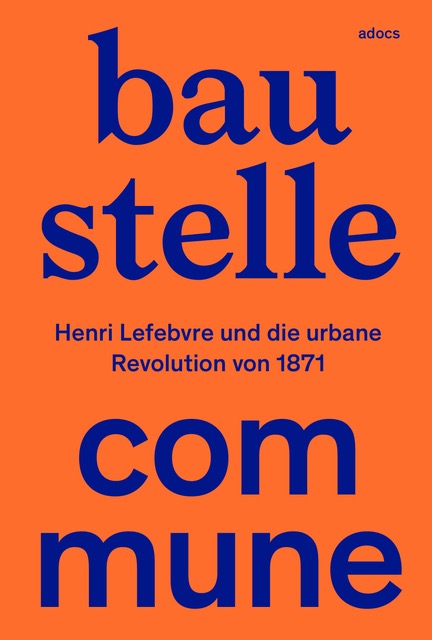
Baustelle Commune
Henri Lefebvre und die urbane Revolution von 1871
15. Dezember 2023
Kohlenrutsche und dérive – Verein für Stadtforschung laden zu:
Buchvorstellung und Diskussion mit Moritz Hannemann, Klaus Ronneberger, Laura Strack und Jan Lemitz
In Auseinandersetzung mit der Pariser Commune von 1871 entdeckt Henri Lefebvre das revolutionäre Potential urbaner Gesellschaften. Das Thema Stadt rückt ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Er begeistert sich für frühe Formen zivilgesellschaftlicher Selbstorganisation und beschreibt die Bedeutung sozialräumlicher Widersprüche für die Entstehung staats- und machtkritischer Bewegungen.
Mit den gegenwärtigen Einhegungen von Stadt, öffentlichem Raum und urbaner Gemeinschaft durch Kapital, Technologie und Polizei werden Lefebvres im Vorfeld von 1968 notierten Beobachtungen wieder aktuell. Was ist aus seinen Beschreibungen der Pariser Commune für das Recht auf Stadt heute zu lernen? Welche Praktiken und Begriffe eines „revolutionären Urbanismus“ finden sich in zeitgenössischen Erfahrungen?
Infos zum Buch:
Baustelle Commune. Henri Lefebvre und die urbane Revolution von 1871, hrsg. von Moritz Hannemann, Klaus Ronneberger u. Laura Strack, mit Fotografien von Jan Lemitz und einem Vorwort von Ulrike Haß, adocs Produktion & Verlag, Hamburg 2023, 340 S.

On the Production of Architecture
10. November 2023
Mit: Marisa Cortright
Moderation: Michael Klein / ÖGFA
Vortrag in englischer Sprache
„Stop Building Now“ might be read not only as an ecological call against the paradigm of endless growth, but also as an incitement to strike: Behind the production of architecture there are relations of production, or: labour conditions, wage schemes or commissional situations, that all remain unmentioned in the public debate. The claim for the great repair, the rebuilding of architecture articulated from all sides must not only concern the cities, the spaces or the role of the practice but in needs to be extended to the institutional self-understanding in the production of architecture, that is it needs to include all the participants and their relations of labour.
Does stopping building mean stopping working? How might calls for a moratorium on new construction amplify newly emergent labor organizing amongst architectural workers, and vice versa? What will architectural work look like after building, and can architectural workers position themselves as the arbiters of value in a post-building scenario?
Marisa Cortright is an architectural worker based in Zagreb. She is currently a Guest Researcher at ArkDes in Stockholm and the Guest Editor of the Avery Review at Columbia University GSAPP. In 2021, she published a book of essays, “‘Can This Be? Surely This Cannot Be?’ Architectural Workers Organizing in Europe” with the VI PER Gallery in Prague.

Jesko Fezer
Umstrittene Methoden
21.Jänner 2023, 19:30 Uhr
Buchvorstellung und Gespräch
Moderation: Brigitte Felderer
Das Wohnprojekt Kohlenrutsche, dérive – Verein für Stadtforschung und die ÖGFA – Österreichische Gesellschaft für Architektur laden ein:
Jesko Fezer spricht anhand der Thesen des Buches Umstrittene Methoden – Architekturdiskurse der Verwissenschaftlichung, Politisierung und Mitbestimmung in den 1960er Jahren über parteiische Gestaltung und diskutiert Argumente für ein gesellschaftlich emanzipiertes Entwerfen.
Umstrittene Methoden
Das Design Methods Movement war eine sehr unbeliebte Bewegung, so unbeliebt, dass sogar ihre Begründer*innen sich bald von ihr distanzierten. Hartnäckige Auseinandersetzungen über die Art und Weise des Entwerfens legten die politische Dimension von Gestaltung sowie die Notwendigkeit sehr weitgehender Partizipation offen. Die Entwurfsmethodik problematisierte sich selbst und hinterfragte die neutrale Expert*innenrolle von Entwerfer*innen zugunsten offenerer und intensiverer Beziehungen zur gesellschaftlichen Wirklichkeit – eine durchaus destruktive zentrale Forderung am Ende der Bewegung.
Jesko Fezers Buch Umstrittene Methoden folgt den Konflikten um die Begründbarkeit des Entwerfens von der HfG Ulm über Horst Rittel und Christopher Alexander bis zum Design Methods Movement und den dort engagierten Architekten wie John Habraken und die S.A.R, Yona Friedman oder die Architektur Machine Group. Dort wie auch im späteren deutschsprachigen Methodendiskurs um 1968, der von Jürgen Joedicke und der neugegründeten ARCH+ geprägt wurde, sowie im kaum aufgearbeiteten Feld der methodisch motivierten Anwaltsplanung – vom Architects’ Renewal Committee Harlem und Urban Planning Aid Boston bis zur portugiesischen SAAL – lässt sich eine verdrängte engagierte und (selbst-)kritische Gestaltungspraxis rekonstruieren.
Jesko Fezer arbeitet als Gestalter zu gesellschaftlichen Relevanz entwerferischer Praxis. In Kooperation mit ifau realisiert er Architekturprojekte, ist Mitbegründer der Buchhandlung Pro qm in Berlin sowie Teil der Kooperative für Darstellungspolitik. Er gibt die Bauwelt Fundamente und die Studienhefte für problemorientiertes Design mit heraus. Er ist Professor für Experimentelles Design an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg und betreibt mit Studierenden seit 2011 die Öffentliche Gestaltungsberatung St. Pauli.